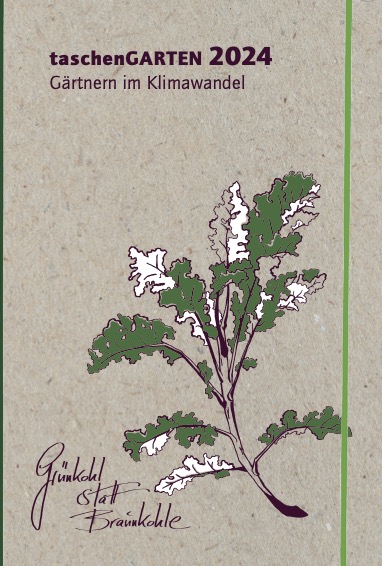Ob pink glitzernde Blätter oder zarte grüne Triebe – Magentaspreen und der Weiße Gänsefuß bringen nicht nur Farbe, sondern auch echte Vielfalt in deinen Selbstversorgergarten. Diese alten Kulturpflanzen sind pflegeleicht, essbar und erstaunlich robust – perfekt für alle, die ihren Garten zukunftsfähig und genussvoll gestalten wollen.

Was ist Magentaspreen – und warum solltest du die farbige Variante des weißen Gänsefußes kennen?
Magentaspreen oder auch Magentamelde (Chenopodium giganteum), ist eine alte Kulturpflanze aus den Himalaya-Regionen Indien, Nepal und Tibet, die nicht nur ihre dekorative Seite in unseren naturnahen Gärten und Selbstversorgerbeeten feiert. Mit ihrem leuchtenden Magentaton an den jungen Blatttrieben zieht sie alle Blicke auf sich. Verwandt ist Magentaspreen mit dem Weißen Gänsefuß (Chenopodium album), beide wilden Gänsefußgewächse (Chenopodiaceae) gehören zur Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae).
Was viele nicht wissen: Auch Spinat und Quinoa zählen zur großen Familie. Und genau wie seine Verwandten ist Magentaspreen oder auch der Weiße Gänsefuß nicht nur eindrucksvoll, sondern auch essbar, pflegeleicht und robust.
So erkennst du den Weißen Gänsefuß
- einjährig, krautig
- wächst als ein Trieb oder buschig verzweigt
- kann bis zu 2 Meter hoch werden
- gräulich-weißer, mehliger Belag auf jungen Blättern
- Blätter wachsen wechselständig, dreieckig, leicht gezähnt
- Blätter und Wuchs kann je nach Standort sehr unterschiedlich ausfallen.
- Stängel ist oft rötlich angelaufen
- Die Blüten sind unscheinbar, 5 mm klein, grünlich-weiß und sehr zahlreich in ährenartigen Rispen
Magentaspreen hat dunklere Blätter. Bei mir wachsen sie breiter und größer als beim weißen Gänsefuß. Die Triebspitzen und die Unterseiten junger Blätter sind magentafarben.


Magentamelde im Selbstversorgergarten: Mehr als nur eine Spinat-Alternative
Ich lernte die Magentamelde in einem Wildkräuter-Kurs kennen und integrierte sie wenig später in meinem Garten. Den Weißen Gänsefuß kannte ich bereits als wilde Ackerpflanze bzw. lästiges Unkraut. Beide Pflanzen werden bis zu 2 Meter hoch. Die asiatische Magentaspreen wird sogar bis zu 3 Meter hoch, weshalb sie oft auch Baumspinat genannt wird. Die Gänsefußarten bilden immer wieder neue Triebspitzen. Somit erhöht sich die Erntedauer, je fleißiger man erntet.
Im Vergleich zum herkömmlichen Spinat sind Magentaspreen und Weißer Gänsefuß deutlich weniger krankheitsanfällig, schießen nicht so schnell in Blüte und kommen mit Trockenheit und Wärme erstaunlich gut zurecht. Ideal also für die Selbstversorgung mit wenig Aufwand.
Beide Sorten schließen zudem die Spinatlücke im Sommerhalbjahr. Während herkömmlicher Spinat bereits Anfang Mai in die Blüte übergeht, starten die wilden Vertreter erst ab Mai und bieten junge Blätter bis in den August hinein. Im Herbst können Blütenstände und später Samen geerntet werden. Ab dem Spätsommer wird der kältetolerante Kulturspinat ausgesät und versorgt uns über die dunkle Jahreszeit hinweg. Die wilden Gänsefußarten sind frostempfindlich.

Anbau und Pflege: So kultivierst du Magentaspreen und Weißer Gänsefuß erfolgreich
Die Aussaat erfolgt ab Mitte April direkt ins Beet. Beide Gänsefußgewächse sind Lichtkeimer, das heißt: Saatgut ausbringen und nur leicht andrücken, nicht mit Erde bedecken. Sobald die Pflanze etabliert ist, wächst sie schnell und zuverlässig.
Ein sonniger bis halbschattiger Platz ist ideal. Du brauchst weder viel Wasser noch Dünger. Wichtig: Die jungen Pflanzen wachsen zart und können leicht übersehen oder versehentlich gejätet werden – also gut markieren. Je nahrhafter der Boden, desto üppiger wachsen die Pflanzen.
Wer die Samen nicht selbst gewinnt, findet sie bei Anbietern wie Dreschflegel oder Magic-Garden-Seeds. Ich selbst lasse beide Gänsefuß-Arten unterdessen sich selbst aussäen. Die Samen des Weißen Gänsefußes können 30 und mehr Jahre im Boden überdauern.
Ernte & Verwendung: Magentaspreen und Weißer Gänsefuß kannst du fast das ganze Jahr über nutzen
Die ersten jungen Blätter erntest du bereits wenige Wochen nach der Aussaat ab Mitte Mai. Sie schmecken mild-nussig, etwas herzhaft und erinnern an Spinat. Auch die Triebspitzen und später sogar die Blütenstände bzw. Samen lassen sich verarbeiten.
Am liebsten nutze ich die Triebspitzen und junge Blätter roh im Salat oder Smoothie, blanchiert als Spinatersatz oder in Gemüsepfannen. Die Samen kannst du wie Quinoa kochen oder ein Mehl daraus herstellen. Es ist auch möglich, im Winterhalbjahr Microgreens aus dem Samen zu ziehen.
Doch Vorsicht! Wie alle Gänsefußgewächse enthalten auch diese beiden einen ordentlichen Anteil an Oxalsäure und Saponine. Aus diesem Grund ist es ratsam nur wenig roh und nicht jeden Tag zu essen. Der Oxalsäure-Gehalt kann durch blanchieren in reichlich kochendem Wasser vermindert werden (Kochwasser nicht verwenden). Zudem solltest du nur junge Blätter und Triebspitzen verwenden.
Powerpakete: Inhaltsstoffe für mehr Wohlbefinden
Der Weiße Gänsefuß enthält dennoch viele wertvolle Inhaltsstoffe und darf deshalb immer mal wieder den Speiseplan ergänzen:
- Vitamin A
- Vitamin C
- Kalium
- Zink
- Phosphor
- Magnesium
- Kalzium
- Eisen
- Saponine
- Oxalsäure
In den Samen sind reichlich Mineralien, Vitamin B3, Spurenelemente und Proteine enthalten. Der rote Farbstoff in der Magenta Melde ist Betalaine und wirkt antioxidativ.

Mein Lieblingsrezept: Grüner Smoothie mit Magentaspreen
Wenn ich durch den Garten gehe, pflücke ich mir meistens 2–3 Blätter des magentafarbenen Gänsefußes. Ich falte die Blätter und knappere sie direkt roh. Sie schmecken würzig bis aromatisch.
Jetzt im Sommer, wenn der Salat eine Pause einlegt und der Kohl noch nicht so üppig wächst, kommen in meinem Smoothie vermehrt Wildkräuter. Unter anderem dürfen 3–4 Triebspitzen der Magenta-Melde nicht fehlen. Die Farbe zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht.
Grüner Smoothie, ein Sommerrezept
ergibt 3 Portionen
- 1 Wedel Grünkohl (alternativ Kohlrabiblätter oder Wirsing)
- 2 Handvoll Salatblätter (Pflücksalate, wie Eichblattsalat)
- Wenn vorhanden, etwas Selleriegrün und/oder Rote Beete Blätter
- 3–4 Triebspitzen Magentaspreen oder Weißer Gänsefuß
- 1–2 Handvoll Wildkräuter (Löwenzahn, Spitzwegerich, Giersch, Schafgarbe, Knopfkraut)
- 1 Banane (alternativ ½ Mango)
- 1 Apfel (gerne ein selbst geernteter Klarapfel)
- 1 Portion süßes Obst nach Wahl (Birne, Aprikosen oder Pfirsich)
- ½ Zitrone (wer mag mit Schale)
- 500 ml Wasser
Das Grün, wenn nötig, waschen, etwas zerkleinern und in einen Mixer geben. Obst ebenfalls vorbereiten und kleinschneiden. Zusammen mit dem Wasser cremig mixen.


Je nachdem, wie hoch der rote Anteil in deinem Gemüse bzw. Obst ist, kann der grüne Smoothie nicht ganz so grün aussehen, wie man vermutet. Die roten Farbstoffe im Blattgemüse und Obst lassen das Grün nicht ganz so quietschig aussehen. Geschmacklich ändert sich nichts – immer total lecker!
Wer Wildkräuter nicht kennt und nicht gewöhnt ist, sollte langsam beginnen, Wildkräuter zu integrieren. Auch solltest du 100%ig sicher sein, bei der Bestimmung von Wildkräutern. In meinen Führungen zeige ich dir gerne die wichtigsten und häufig verwendeten Wildpflanzen aus dem heimischen Garten.
Weitere Smoothie-Rezepte:
Wildkräuter-Smoothie: Energy-Kick im Frühling
Maigarten-Smoothie
Ackertantes Newsletter: Infos aus erster Hand.
Klimawandel im Garten: Warum der Weiße Gänsefuß und Magentaspreen Pflanzen der Zukunft sind
In Zeiten zunehmender Trockenperioden und Extremwetterlagen brauchen wir Gemüsepflanzen, die mit diesen Bedingungen klarkommen. Baumspinat ist so eine Art Klimawandel-Gewinner:
- Er wächst auf nahezu allen Böden,
- kommt mit Wärme und weniger Wasser aus,
- vermehrt sich durch Selbstaussaat extrem gut,
- und hat kaum Schädlinge.
Wilde Gänsefußgewächse in der Permakultur
Auch wenn er botanisch einjährig ist, kommen beide Gänsefußarten bei mir jedes Jahr zuverlässig wieder. Er sät sich wunderbar selbst aus. Jahrelang habe ich ihn mühevoll entfernt, unterdessen dürfen die Pflanzen an geeigneten Stellen ungestört wachsen.
Im Permakulturgarten ist es wichtig, einen Mix aus verschiedenen Pflanzen gemeinsam zu kultivieren. Die Gänsefußarten helfen dabei:
- als Schattenspender für empfindliche Pflanzen,
- zur Bodenabdeckung bzw. als frisches Mulchmaterial
- als Stickstoffspeicher im Gründünger,
- und als essbare Strukturpflanze im naturnahen Beet.
- Zudem befördern die langen Wurzeln wichtige Nährstoffe nach oben
- und versorgen damit die Nachbarpflanzen bzw. den Boden.
- Sie sind wichtige Nahrungspflanzen für Raupen und Vögel (Samen).
Der Weiße Gänsefuß wächst gerne ungestört in meinen Kartoffelreihen. Auf den übrigen Beeten lasse ich nur wenige Exemplare stehen, da sie sehr groß werden. Sie können aber auch zurückgeschnitten werden, um den Platzbedarf einzuschränken.
Fazit: Einmal gepflanzt – für immer begeistert
Kaum eine Pflanze hat mich so positiv überrascht wie Magentaspreen. Sie ist dekorativ, essbar, pflegeleicht, klimaresistent und passt perfekt in naturnahe Selbstversorgergärten. Magentaspreen hat mir auch die Augen für den Weißen Gänsefuß geöffnet. Wenn im trockenen, heißen Brandenburger Sommer nichts mehr richtig wachsen will, diese beiden Pflanzen sind immer da!
Übrigens: Kinder lieben die pinken Blätter – es ist fast, als ob Feen sie bepinselt hätten. Probier’s aus: Dein Garten wird es dir danken.
Aktuelle Beiträge
- Selbstversorger-Dinner: Sommer-Gemüsepfanne mit Hirse
- Sommerglück: Zurück im Selbstversorgergarten
- Der Apfel von der Streuobstwiese: Vitalstoffe for free
- Magentaspreen & Weißer Gänsefuß – Farbenfrohe Kraftpakete
- Acker-Ringelblume (Calendula arvensis) – Wildpflanze mit Heilkraft für deinen Garten